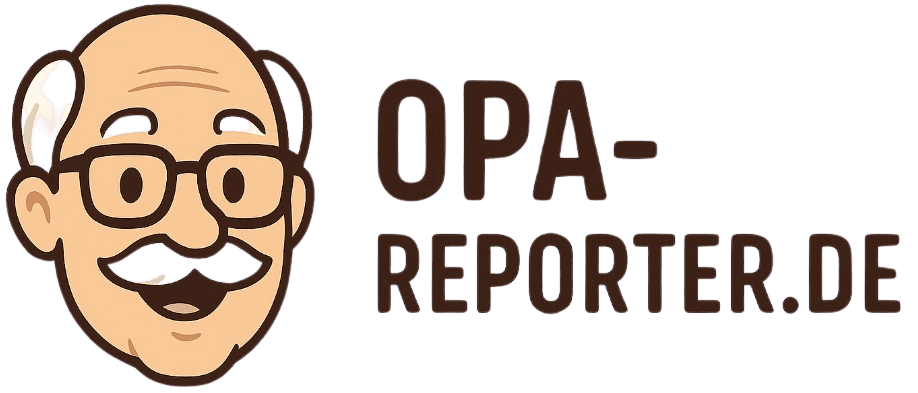Ich bin 72 Jahre alt. Ich habe viel gesehen, viel erlebt und mir über die Jahrzehnte hinweg eine Meinung gebildet. Und genau deshalb sage ich heute ganz bewusst: Ja, Jugendliche ab 16 sollten wählen dürfen. Das ist keine spontane Laune, kein Anflug von Gutmenschentum. Es ist eine Überzeugung, die mit dem Blick auf meine Enkel, auf die Zukunft unseres Landes und auf das, was ich aus der Geschichte gelernt habe, gewachsen ist.
Ein Blick zurück: Demokratie als Schatz
Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man sich das Recht auf freie Wahlen noch frisch erarbeitet hatte. Meine Eltern wussten noch, was es heißt, in einem Regime zu leben, in dem man den Mund nicht aufmachen durfte. Ich erinnere mich an die Erählungen meines Vaters, der in der Nachkriegszeit zum ersten Mal frei wählen durfte. Für ihn war das etwas Heiliges. Dieses Bewusstsein habe ich mitbekommen. Und es ist mir heilig geblieben.
Aber gerade weil ich weiß, wie zerbrechlich Demokratie sein kann, müssen wir sie stärken, wo immer es geht. Und zwar nicht durch Abschottung, sondern durch Beteiligung. Gerade jungen Menschen müssen wir zeigen: „Deine Stimme zählt.“ Denn wenn sie das erst mit 18 erleben dürfen, haben sie vielleicht schon vorher resigniert. Und Resignation ist der Feind jeder Demokratie.
Ich erinnere mich, wie es war, als ich zum ersten Mal gewählt habe. Ich war aufgeregt, stolz, habe die Programme gelesen, diskutiert und mich ernst genommen gefühlt. Diese Erfahrung prägt. Und ich wünsche mir, dass auch junge Menschen diese Prägung früher erleben dürfen.
Die Welt, in der unsere Enkel leben werden
Ich denke oft darüber nach, wie die Welt aussieht, wenn ich nicht mehr da bin. Was wird mit dem Klima passieren? Wie wird das Rentensystem aussehen? Wie gehen wir mit Digitalisierung, KI und globalen Krisen um? Es sind die Jungen, die all das tragen und gestalten müssen. Und genau deshalb sollen sie auch mitentscheiden dürfen.
Meine Enkel sind 15 und 17 Jahre alt. Beide interessieren sich für Politik. Nicht immer so, wie wir das vielleicht früher taten – mit Zeitung und Tagesschau – sondern über Social Media, Diskussionen in der Schule und Gespräche mit Freunden. Aber sie machen sich Gedanken. Sie diskutieren, sind neugierig, stellen Fragen. Und sie wollen Verantwortung übernehmen.
Meine Enkelin engagiert sich inzwischen sogar in der Schülervertretung, mein Enkel hat neulich einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit organisiert. Das ist mehr als bloße Neugier. Das ist aktives Gestalten. Und genau das sollten wir würdigen, statt es zu begrenzen.
Warum also sollten sie keine Stimme bekommen?
Reife ist keine Frage des Alters allein
Ich habe im Laufe meines Lebens viele 40-Jährige erlebt, denen ich keine Wahlentscheidung anvertrauen möchte. Und ich habe 16-Jährige getroffen, die verantwortungsvoll, reflektiert und ernsthaft mit gesellschaftlichen Themen umgehen. Natürlich ist nicht jeder Teenager politisch interessiert. Aber das ist auch nicht jeder Erwachsene.
Das Argument, dass 16- oder 17-Jährige nicht reif genug seien, greift für mich zu kurz. Reife entwickelt sich durch Verantwortung – und durch Beteiligung. Wer von Anfang an lernt, dass seine Stimme zählt, wird auch eher Verantwortung übernehmen. Das ist wie beim Fahrradfahren: Man lernt es nicht, indem man zuschaut, sondern indem man es macht.
Viele junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich, helfen in der Nachbarschaft, betreuen jüngere Kinder oder organisieren Veranstaltungen an ihren Schulen. Das zeigt doch: Sie können Verantwortung übernehmen – und wollen es auch.
Bildung statt Ausschluss
Wer sagt, die Jugendlichen wissen zu wenig über Politik, der hat teilweise recht – und das ist genau der Punkt! Wenn wir das Wahlalter absenken, dann müssen wir auch politisch bilden. In der Schule, aber auch zu Hause, in der Gesellschaft, in den Medien. Wir müssen jungen Menschen zutrauen, sich eine Meinung zu bilden. Und wir müssen ihnen die Werkzeuge geben, dies auch fundiert zu tun.
Ich sehe es bei meinen Enkeln: Wenn ein Thema sie packt, dann graben sie sich richtig rein. Dann schauen sie Videos, lesen Artikel, diskutieren in Gruppen. Man muss sie nur ernst nehmen und ihnen etwas zutrauen.
Vielleicht brauchen wir sogar ein eigenes Fach in der Schule, das politische Bildung noch stärker in den Fokus rückt. Nicht trocken und abstrakt, sondern lebensnah und mit aktuellem Bezug. Demokratie kann man üben. Und je früher wir damit anfangen, desto besser.
Ein aktives Wahlrecht ist Teil des Erwachsenwerdens
Mit 16 darf man eine Ausbildung beginnen, arbeiten gehen, in bestimmten Fällen selbst Verträge abschließen. Wer Verantwortung tragen darf, sollte auch mitentscheiden dürfen. Politik betrifft alle Lebensbereiche – und damit auch Jugendliche.
Wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, dann waren es oft gerade politische Themen, die uns bewegt haben. Atomkraft, Nachrüstung, die Friedensbewegung – das waren keine „alten Themen“. Das war unser Alltag. Nur: Wir durften nicht mitentscheiden. Heute denke ich: Was für eine vertane Chance.
Ich frage mich oft: Hätten wir damals mehr Einfluss gehabt, wären manche gesellschaftlichen Entwicklungen anders verlaufen? Hätte man mehr auf die jungen Stimmen gehört, hätten wir vielleicht schon früher Kurskorrekturen erlebt.
Demokratie lebt vom Mitmachen
Ich glaube, dass unsere Demokratie genau das braucht: mehr Mitmachen. Mehr Gespräch über das, was uns bewegt. Mehr Vielfalt der Stimmen. Mehr Beteiligung. Das heißt auch: Junge Menschen frühzeitig einbinden. Ihnen nicht das Gefühl geben, sie müssten erst alt genug sein, um ernst genommen zu werden.
Wer mit 16 das erste Mal wählen darf, der macht sich Gedanken. Vielleicht nicht alle, aber viele. Und sie tragen diese Gedanken in ihre Familien, ihre Freundeskreise, ihre Schulklassen. Sie bringen Bewegung in die Gespräche – und das ist gut so.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Enkel über das bedingungslose Grundeinkommen. Er hat Argumente gebracht, die mir neue Perspektiven aufgezeigt haben. Das war kein oberflächliches Geschwätz, das war durchdacht. Und genau solche Diskussionen brauchen wir.
Vertrauen statt Misstrauen
Ich verstehe die Sorgen mancher Menschen. Dass Jugendliche leichter beeinflussbar seien, dass sie zu spontan entscheiden, dass sie „noch nichts vom Leben wissen“. Aber wenn wir ehrlich sind: Wer weiß das schon? Auch wir Erwachsenen lassen uns beeinflussen. Von Medien, von Parolen, von Emotionen.
Der Unterschied ist: Wir trauen uns gegenseitig zu, damit umgehen zu können. Warum nicht auch unseren Kindern und Enkeln?
Ich habe gelernt: Vertrauen schenkt man nicht erst, wenn jemand perfekt ist. Vertrauen ist der Anfang. Es ist eine Haltung. Und genau das brauchen wir in unserer Demokratie.
Wenn wir jungen Menschen Misstrauen entgegenbringen, was lernen sie dann? Dass sie nicht genügen. Dass sie erst „irgendwann“ wichtig sind. Und das wäre eine fatale Botschaft.
Mein Wunsch für die Zukunft
Ich wünsche mir, dass meine Enkel eines Tages sagen können: „Mein Opa hat für mich mitgesprochen, als ich noch keine Stimme hatte.“ Und noch lieber wäre mir, sie könnten sagen: „Ich durfte mitentscheiden, von Anfang an.“
Denn genau darum geht es: Unsere Gesellschaft gemeinsam zu gestalten. Mit Herz, mit Verstand, mit allen Generationen. Und das heißt auch: Das Wahlrecht ab 16.
Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft den Mut aufbringen, jungen Menschen mehr zuzutrauen. Nicht nur in der Theorie, sondern ganz konkret an der Wahlurne. Denn nur so lernen sie, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für andere.